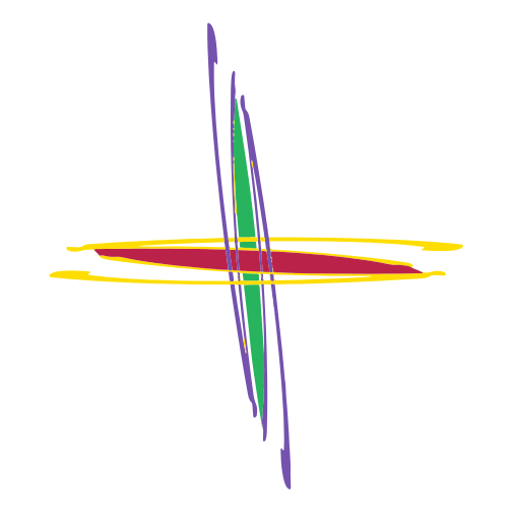Gedanken zur FriedensDekade 2018 in Fürstenfeldbruck
Mit drei Gebetstreffen vor der Fürstenfeldbrucker Kirche St. Leonhard und einem Abend in der Gnadenkirche mit Lyrik, Texten und Musik zu Frieden und Krieg aus zwei Jahrtausenden hat sich der Christenrat Fürstenfeldbruck/Emmering an der FriedensDekade 2018 in der Woche vom 13. bis 16. November beteiligt.
Der Abend in der Gnadenkirche begann mit dem Propheten Micha (4,1-4): „In den letzten Tagen“ werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Nicht der Prophet macht diese Verheißung, sondern durch seinen Mund Gott selbst: „Denn der Mund des Herrn Zebaot hat es geredet.“ Micha lebte im 8. Jahrhundert v. Chr., und seitdem kennen Juden und Christen Gottes Verheißung. Jeder von uns weiß: Diese Verheißung Gottes ist in der Welt nicht Wirklichkeit geworden. Seit den Tagen Michas erlebten und erleben die Menschen das Gegenteil. Krieg, nicht Frieden ist der Alltag.
Von diesem Alltag der Gewalt, des Terrors, des Kriegs berichteten neun Gedichte vom 17. bis zum 20. Jahrhundert ihrer Versform und poetischen Sprache. Die Texte provozierten, wie es kaum ein Prosastück vermocht hätte.
„Tränen des Vaterlandes“ nennt Andreas Gryphius sein Anti-Kriegsgedicht von 1637 – mitten im Dreißigjährigen Krieg. Das Vaterland, in dessen Namen angeblich Kriege geführt werden müssen, weint, denn es ist verwüstet, die Schwerter sind voller Blut, die Flüsse von Leichen verstopft. Ärger als die Pest, der Hunger und der Tod ist aber, so schließt Gryphius, „der Seelen Schatz / so vielen abgezwungen“. Das kann man auch den Kirchen zurufen, die so oft die Waffen gesegnet haben.
„s´ ist leider Krieg – und ich begehre nicht schuld daran zu sein“. So beginnt Matthias Claudius sein Kriegslied von 1778. Redet sich da einer allzu leicht aus der persönlichen Verantwortung? Nein, aber er sagt den Opfern, die „blutig, bleich und blass“ im Schlafe zu ihm kommen, sie selber, nicht er, habe den Krieg hervorgerufen, und er hält ihnen die Gründe für ihre Kriegsbegeisterung vor: „Kron und Land und Gold und Ehre“. Als wär´s ein Stück von heute, so klingt Theodor Fontanes „Das Trauerspiel von Afghanistan“ von 1839. „Mit dreizehntausend der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan.“
Marie Luise Kaschnitz beklagt 1951 in „Hiroshima“ entsetzt, dass der Atombombenpilot keine Reue empfand, sondern als Held stilisiert wurde. Ingeborg Bachmann resigniert 1952 in „Alle Tage“, dass das Unerhörte alltäglich geworden ist: „Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.“ Dann aber keimt Hoffnung auf, sie kehrt die Verhältnisse um: Flucht vor den Fahnen, „Tapferkeit vor dem Freund“, „Verrat unwürdiger Geheimnisse“, „Nichtbeachtung jeglicher Befehle“ werden zu Tugenden, zu Voraussetzungen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Hilde Domin beschwört in „Abel steh auf“ aus dem Jahr 1978 die Umkehr der alten Mordgeschichte vom Anfang der Schöpfung: wenn der von seinem Bruder Kain erschlagenen Abel aufsteht, wenn Kain statt zum Mörder zu Abels Bruder wird, dann braucht es keine Gesetzbücher und auch keine Kirchen mehr. Dann ist die Gewalt aus der Welt, alles kann noch einmal beginnen und gut werden. Die 17jährige Selma Meerbaum-Eiseler hat in ihrem „Poem“ von 1941 nur einen Wunsch: „Ich möchte leben. Ich möchte lachen und Lasten heben … und lieben … und frei sein … Ich will nicht sterben. Nein!“ Stattdessen hört sie brüllende Kanonen, sieht ein massenhaftes „Hauf um Hauf sterben sie.“ Pavel Matev mahnt in „Die Signale“ wachsam zu sein und schon weit im Vorfeld des Krieges „dumpfe Warnsignale“ wahrzunehmen. Mit Walter Lowenfelds Gedicht „Der große Friede“ endete die Lesung: „Was ist schöner als ein Land, das kein Grab hat … weil da kein Feind ist.“ Und überall scheint das „Licht der Weisheit.“
Kurze Musikstücke des Münchner Keller-Quintett gaben den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Fürstenfeldbrucker evangelischen Gnadenkirche Zeit, die Texte zu reflektieren. Sich von ihrer Provokation zu erholen. Oder weiter zu denken. Weiter zu bitten. Weiter zu träumen. Manchmal klang die Musik nachdenklich. Manchmal flehentlich. Manchmal wütend. Manchmal anklagend. Manchmal hoffnungsfroh. Aber niemals klang die Musik triumphierend.
Vor den Gedichten, zu Anfang des Abends, war der Text des Propheten Micha (4,1-4) verlesen worden. Die Gedichte zeigten den brutalen Kontrast zwischen Gottes Verheißung des Friedens und dem Alltag des Kriegs über die Jahrhunderte hinweg. Auffällig ist, dass nur einer der neun Dichterinnen und Dichter auf Gott zu sprechen kommt: „s´ ist Krieg! s´ ist Krieg! O Gottes Engel wehre, und rede du darein!“ beginnt Matthias Claudius sein Gedicht mit einem Schrei nach Gott. Ansonsten ist Gott kein Thema. Soll das heißen: Mit Krieg, mit Gewalt hat Gott nichts zu tun? Und weiter: Das ist allein Eure Sache, Eure Schuld, Ihr Menschen?
Die Organisatoren des Abends, Vera Gedon, Elisabeth Tocha-Ring und Dr. Rupert Habersetzer, ließen die Gäste mit diesen Fragen nicht allein. Nach den Gedichten gaben die Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt 5,3-10) Antwort auf Michas Prophetie und zeigten einen Weg aus der Resignation, die einen angesichts der Brutalität der Schreie in den Gedichten befallen konnte. Ja, Schwerter können zu Pflugscharen werden, wenn sich die Menschen ändern, in ihrer inneren Haltung und in ihrem äußeren Verhalten. Wenn sie arm vor Gott werden. Über die Welt trauern und sich nicht mit ihrem desolaten Zustand zufriedengeben, sondern nach Gerechtigkeit streben, Barmherzigkeit üben. Wenn sie ein reines Herz haben und nicht nach Tapferkeit vor dem Feind, nach Uniformen und Auszeichnungen gieren. Dann und nur dann können sie Frieden stiften. So sagt es Jesu Bergpredigt.
Ganz am Schluss dieses meditativen, eindrucksvollen Abends spielte das Keller-Quintett eine Motette von Heinrich Schütz: „Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsren Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du unser Gott, alleine.“ Gottes Antwort aber ist in der Bergpredigt gegeben: Es ist der Mensch, der Kriege vom Zaum bricht. Es ist der Mensch, der die Gewalt beenden kann. Die Motette will aber zeigen, dass er dazu Gott braucht.
Wie aber kann der Mensch Gott erreichen? Indem er nach dem Frieden strebt und indem er betet. Das Gebet um Frieden war denn auch Teil der FriedensDekade 2018 in Fürstenfeldbruck. An drei Abenden standen Mitglieder des Christenrats mit einem Transparent „FriedensDekade. Schwerter zu Pflugscharen“ jeweils eine gute Viertelstunde vor der Kirche St. Leonhard. Sie lasen biblische Texte, beteten Psalmen und das Vater unser, sie sangen religiöse Lieder. Große Aufmerksamkeit der Passanten erregten sie nicht. Und sie blieben ein kleines Häuflein, an einem Tag fünf, dann neun, dann acht. Wie aber heißt es in der Bibel: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) Auch wenn der Aufruf zum Friedensgebet in Fürstenfeldbruck wenig gehört wurde, woanders wird er angekommen sein.
Dr. Bernd Hein